Events für Alumni des Dualen Masters
Alumni des Dualen Masters der DHBW haben die Möglichkeit, sich standortübergreifend zu vernetzen. Besuchen Sie eine der Veranstaltungen in Ihrer Nähe und werden Sie Teil des großen Alumni-Netzwerks.
Wir freuen uns auf Sie!
Veranstaltungskalender für Alumni
12.09.2025
17.30 - 21.00 Uhr
connect & grow - Vernetzen. Lernen. Wachsen. Workshop zum Thema Einführung in Künstliche Intelligenz und Prompting und anschließender Weindorfbesuch
Künstliche Intelligenz (KI) verändert unsere Arbeitswelt – doch was genau steckt dahinter? Wie funktioniert KI, wie kann ich sie sinnvoll in meinem Berufsalltag nutzen? In dieser Einführung erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen der KI. Im Anschluss wollen wir gemeinsam das Heilbronner Weindorf besuchen. Weiterlesen
DHBW Center for Advanced Studies
Bildungscampus 13
Veranstaltungen für Alumni an den Standorten der DHBW
Rückblick auf vergangene Workshops und Vorträge
Zur Diskussion dieser hochaktuellen Frage trafen sich rund 70 Teilnehmer*innen mit Prof. Dr.-Ing. Martin Freitag zur Online-Veranstaltung des DHBW CAS. In einem motivierenden Vortrag präsentierte der ehemalige Dekan der Fakultät Technik und Prorektor der DHBW Ravensburg seine Ideen für eine CO2-neutrale Zukunft. Die intensive Fragerunde im Anschluss zeigte, wie viele Fragen dieses Ziel aktuell noch aufwirft.
„Vieles, was in den Medien zu dem Thema angeboten wird, ist wenig sachlich oder sogar falsch und führt eher zu Verwirrung. Daher möchte ich aus dem Blickwinkel des Ingenieurs etwas zur Transparenz beitragen“, startet Prof. Dr.-Ing. Martin Freitag seinen einstündigen Vortrag „CO2-neutrale Energiewirtschaft bis 2050 - ist das realistisch?“
Und tatsächlich erfahren die Zuhörer viele technische und ingenieurwissenschaftliche Fakten und Details. Vor allem aber präsentiert Freitag den Entwurf einer CO2-freien Energiewirtschaft. Er bleibt dabei realistisch: „Der Aufwand und die notwendigen Investitionen zur Vermeidung von CO2-Emissionen sind hoch, aber nichts zu tun wird langfristig noch teurer“, so seine Überzeugung.
Was er empfiehlt? Einerseits das Einsparen von Energie in allen Bereichen. Zugleich regt er an, die Verluste bei der Gewinnung, der Umwandlung, dem Transport und der Nutzung von Energie zu minimieren. „Die Basis einer CO2-freien Energiewirtschaft kann in Deutschland nur die Nutzung von Solar- und Windenergie sein. In der Industrie, im Verkehr und in den Haushalten werden verschiedene Energieträger benötigt, die aus dem grünen Strom hergestellt werden. Dabei spielen die Power-To-Gas- (Methan) und Power-To-Liquid- (Methanol) Techniken eine tragende Rolle. CO2-neutral erzeugtes Methan und Methanol lassen sich mit der vorhandenen Infrastruktur speichern, transportieren, verteilen und nutzen.“ Viele dezentrale Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme erzeugen, sollen die Aufgaben der heutigen kohlebetriebenen Kraftwerke übernehmen.
Dieses Verfahren hat auch Nachteile, die Freitag in seine Überlegungen einbezieht: „Natürlich ist Methan auch ein Treibhausgas. Es wirkt jedoch gegenüber dem Kohlendioxid in der Atmosphäre nur etwa zwölf Jahre klimaschädlich; CO2 dagegen mehrere tausend Jahre. So stellt sich bezüglich der Klimawirkung beim Methan ein akzeptierbares Gleichgewicht auf niedrigem Niveau ein.“ Auch der notwenige enorme Ausbau der Sonnen- und Windenergie ist für ihn ein hochrelevantes Thema. Genauso wie der große Forschungsbedarf bei der Optimierung der Teilprozesse in einer Methan- bzw. Methanol-Energiewirtschaft. Noch ist hier sehr viel zu tun. Doch Freitag zeigt, dass sein Entwurf die aus jetziger Sicht günstigste Lösung ist, die globale Erwärmung zu reduzieren.
Ist denn nun eine CO2-neutrale Energiewirtschaft bis 2050 realistisch? Der Referent gibt hierauf eine zweigeteilte Antwort: Er sieht dieses Ziel für Deutschland als erreichbar an, auch wenn das viel Aufwand und hohe Kosten bedeutet. „Eine weltweite Umsetzung bis zu diesem Zeitpunkt ist nicht zu schaffen“, meint er.
Was denn neben intensiver Forschung und Investitionen noch nötig wäre, um das Ziel zu erreichen, fragt ein Teilnehmer dann in der Diskussion. Auch hier hat der Wissenschaftler eine klare Antwort: „Da muss sich vor allem auch in den Köpfen der Menschen etwas tun und der gesellschaftliche Druck zum Wandel weiter wachsen. Die Technik kann einen wesentlichen Beitrag leisten, indem sie die die Voraussetzungen zur Lösung des Problems schafft.“
Wer weiter in das Thema einsteigen will, findet den Vortrag sowie weitere Videos zum Thema auf YouTube.
Die Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie ebenfalls auf YouTube.
Rund 100 Zuhörer*innen folgten am 19. Oktober dem Alumni-Vortrag von Dr. Ralph Lux und diskutierten intensiv mit. Die Online-Veranstaltung des Masterstudiengangs Maschinenbau ist eine von vielen Alumni-Angeboten des DHBW CAS.
Batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellen oder doch Hybridantriebe? Welches ist der Antrieb von morgen? Unter dieser Leitfrage analysierte Dr. Ralph Lux, Dozent am DHBW CAS und Trainer für Elektromobilität, verschiedene Antriebstechnologien für Fahrzeuge. In seinem Vortrag mit rund 100 Zuhörer*innen ging er auf Kriterien wie Klima, Luftqualität und Nachhaltigkeit ein. Er thematisierte aber auch den Stand der jeweiligen Technik, die benötigten Energiemengen für Herstellung und Betrieb sowie vorhandene und fehlende Infrastruktur.
Dabei wurde deutlich, dass es unterschiedliche Antriebsarten mit jeweiligen Stärken und Schwächen gibt. „Es wird zukünftig verschiedene Antriebsarten geben und jeder wird sich die aussuchen, die für seinen Anwendungsfall Sinn macht“, ist Lux überzeugt. So sind Stadtbusse anderen Anforderungen ausgesetzt als private PKW oder gewerblich genutzte LKW.
Ein Hauptthema in der Diskussion war dann die Frage der Nachhaltigkeit und der Emissionen. Ist der Batteriebetrieb im Vorteil? Lux schränkt dies ein: „Ziel muss sein, E-Fahrzeuge mit grünem Strom zu fahren und für die Autoteile eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren. Da sind wir noch nicht.“ Und damit macht er deutlich, dass zwei große Herausforderungen bestehen: Einerseits das Thema Nachhaltigkeit bei der Produktion neuer Technik und dem Recycling, beispielsweise von Batterien. Hier würden neue Geschäftsfelder entstehen, die erst noch wachsen müssen, ist Lux sicher. Ein zweiter und grundlegender Entwicklungsschritt steht den Mitarbeiter*innen der entsprechenden Branchen bevor: „Für alle Mitarbeiter*innen wird es wesentlich, E-Mobilitäts-Kompetenzen und -wissen aufzubauen“, mahnt der Trainer für Elektromobilität.
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Schorr, Wissenschaftlicher Leiter des Masterstudiengangs Maschinenbau, hat dazu gute Nachrichten: „Wir haben schon vor ein paar Jahren erkannt, dass das Thema alternative Antriebe wesentlich ist und entsprechende Module und Weiterbildungsangebote auf den Weg gebracht – im Master Maschinenbau und in Zertifikatsprogrammen mit spezifischen Schwerpunkten.“ Hier kann das DHBW CAS die Entwicklung mit neuem Wissen positiv unterstützen.
Die lang über den Vortrag hinausgehende Fragerunde der Zuhörer*innen und Alumni mit unterschiedlichsten Themen und Positionen machte abschließend sehr deutlich, dass die Antriebstechnologien von morgen enorme Relevanz haben. Das Thema ist stark nachgefragt und noch lange nicht gelöst.
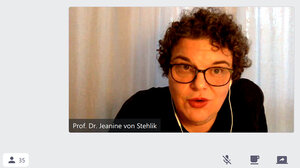
„Wahrnehmung kommt nicht von Wahrheit“, veranschaulichte Prof. Dr. Jeanine von Stehlik während eines exklusiven Workshops für die Master-Alumni des DHBW CAS.
„Wie hoch liegt die Impfquote einjähriger Kinder weltweit?“ Prof. Dr. Jeanine von Stehlik führte die Teilnehmer*innen ihres Workshops direkt aufs Glatteis: Wir bewerten oft zu negativ. Auch die Alumni des DHBW CAS schätzten die Quote falsch ein. Tatsächlich liegt sie laut Weltgesundheitsorganisation bei über 80 Prozent. Aufgrund unseres Instinkts der Negativität nehmen wir das Schlechte leichter an als das Gute, erläuterte von Stehlik, die den Studiengang Unternehmertum an der DHBW Karlsruhe leitet. Zudem lieben wir instinktiv klare Ja-Nein-Entscheidungen, die uns das Leben auf den ersten Blick einfach machen. Das helfe aber heute, in einer hochkomplexen Welt nicht mehr weiter, wusste die Professorin.
Business-Talk: Corona, Suez, Klimawandel: Steht die globale Lieferkette vor dem Aus?
Die moderne Wertschöpfungskette ist eine internationale, oft eine globale. Güter finden ihren Weg entsprechend der höchsten Effizienz: von Produktions-, Montage-, Lager-, Umschlags- und Handelsknoten bis zum Endkunden zuhause. Eine solche global vernetzte Lieferkette ist damit grundsätzlich anfällig für Störungen, die von wirtschaftlichen Entscheidern rechtzeitig erkannt und beseitigt werden müssen.
Was bedeutet dies für eine hoffentlich kommende Nach-Corona-Zeit? Verlagerung der Produktion zurück nach Europa? Das Ende der Just-in-time-Produktion? Neue Transportwege? Oder genügen vereinzelte Anpassungen von Parametern, bspw. von Bestellmengen oder Durchlaufzeiten?
Vortrag: Data driven Engineering als Erfolgsfaktor am Beispiel der Antriebsentwicklung
Wie tiefgreifend die Transformation durch neue Technologien in der Automobilindustrie ist und welche Chancen und Herausforderungen darin liegen, stellten Dr. Bruno Kistner und Dr. Peter Fietkau von der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in einem praxisnahen Impulsvortrag rund 40 Interessierten vor. Ihre zentrale Botschaft: Veränderung findet auf drei Ebenen statt – in der Technologie, aber auch im notwendigen Mindset der Teams und in der Führungskultur. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr.-Ing. Dietmar Schorr, dem Wissenschaftlichen Leiter des Masterstudiengangs Maschinenbau am DHBW CAS.








